Digitales Programmheft zu:
Mephisto:
nach dem Roman von Klaus Mann:
Bühnenbearbeitung von Luk Perceval
Bühnenbearbeitung von Luk Perceval
Teaser:
Interview mit Luk Perceval:
Regisseur Luk Perceval spricht darüber, was ihn an der Buchvorlage reizt, warum das Thema zeitlich hochaktuell ist und was mit dem "Tanz auf dem Vulkan" gemeint ist.
Resonanzraum für die Gegenwart:
Was für eine Geschichte ist es denn, die ich zu erzählen habe? Die Geschichte eines Intellektuellen zwischen zwei Weltkriegen, eines Mannes also, der die entscheidenden Lebensjahre in einem sozialen und geistigen Vakuum verbringen musste: innig – aber erfolglos – darum bemüht, den Anschluß an irgendeine Gesellschaft zu finden, sich irgendeiner Ordnung einzufügen: immer schweifend, immer ruhelos, umgetrieben, immer auf der Suche …Klaus Mann
Lange stand das Werk von Klaus Mann im Schatten seines Vaters Thomas Mann; erst posthum wurden seine Texte vermehrt als Spiegel der deutschen Gesellschaft der Vorkriegs- und Kriegsjahre rezipiert. So gilt Klaus Manns 1936 im Exil geschriebenes Buch „Mephisto. Roman einer Karriere“ als ein Schlüsselwerk dieser Zeit. Die satirische Geschichte folgt dem Aufstieg von Hendrik Höfgen, der es im sogenannten „Neuen Reich“ vom Provinzschauspieler bis zum gefeierten Intendanten schafft. Auch wenn Klaus Mann zeitlebens darauf verwies, dass er mit Höfgen kein Portrait einer bestimmten Person erzählen wollte, sondern vielmehr einen Typus darzustellen versuchte, ist die Figur eindeutig an den realen Schauspieler Gustaf Gründgens angelehnt. Gründgens war von 1925-28 mit Klaus Manns Schwester, Erika Mann, verheiratet und erlangte große Berühmtheit in der Rolle des Teufels Mephisto in Goethes „Faust“. Den Roman lediglich als Abrechnung mit dem verhassten Schwager zu deuten, greift sicherlich zu kurz. Dennoch war der Roman aufgrund eines Gerichtsurteils zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte von Gustaf Gründgens über Jahrzehnte in West Deutschland verboten. Als er den Roman 1936 schrieb, wusste Klaus Mann nichts von den noch kommenden Gräueltaten des NS-Regimes. Der Text stellt die allgemeingültige Frage nach der Verantwortung des Einzelnen in einem demokratiefeindlichen Staat und bietet einen bemerkenswerten Resonanzraum für die Gegenwart.
Der Regisseur Luk Perceval interessiert sich in seiner Bühnenadaption des Werks vor allem für die Scham über das eigene (Nicht-)Handeln. Auf einer leeren Bühne, mitten im Theater, trifft Hendrik Höfgen auf die Geister seiner Vergangenheit: Seine erste Ehefrau Barbara Bruckner, sein Theater-Rivale Hans Miklas, sein Freund Otto Ulrichs, seine Kollegin und zweite Ehefrau Nicoletta von Niebuhr und seine Geliebte Juliette Martens, sie alle dringen in Höfgens Imagination ein und fordern Rechenschaft. Perceval lässt die Spielenden rasant von den genannten engen Vertrauten Höfgens in andere Figuren springen und entwickelt so ein Panorama seines Lebens. In enger Zusammenarbeit mit dem Choreografen Ted Stoffer entsteht ein „Tanz auf dem Vulkan“ – alle feiern und tanzen während die Erde unter ihren Füßen gefährlich bebt. Die Komposition von Karol Nepelski unterstützt die Atmosphäre einer stetig ansteigenden Bedrohung durch eine Collage aus Textfragmente der Figuren, Versatzstücken aus NS-Reden sowie physischen Sounds der Schauspielenden. Das Bühnenbild von Philip Bußmann und die Kostüme von Ilse Vandenbussche akzentuieren das Sujet des Theaters und stellen damit Höfgens selbstgewählte Heimat – die Bühne – in den Vordergrund.
Der Regisseur Luk Perceval interessiert sich in seiner Bühnenadaption des Werks vor allem für die Scham über das eigene (Nicht-)Handeln. Auf einer leeren Bühne, mitten im Theater, trifft Hendrik Höfgen auf die Geister seiner Vergangenheit: Seine erste Ehefrau Barbara Bruckner, sein Theater-Rivale Hans Miklas, sein Freund Otto Ulrichs, seine Kollegin und zweite Ehefrau Nicoletta von Niebuhr und seine Geliebte Juliette Martens, sie alle dringen in Höfgens Imagination ein und fordern Rechenschaft. Perceval lässt die Spielenden rasant von den genannten engen Vertrauten Höfgens in andere Figuren springen und entwickelt so ein Panorama seines Lebens. In enger Zusammenarbeit mit dem Choreografen Ted Stoffer entsteht ein „Tanz auf dem Vulkan“ – alle feiern und tanzen während die Erde unter ihren Füßen gefährlich bebt. Die Komposition von Karol Nepelski unterstützt die Atmosphäre einer stetig ansteigenden Bedrohung durch eine Collage aus Textfragmente der Figuren, Versatzstücken aus NS-Reden sowie physischen Sounds der Schauspielenden. Das Bühnenbild von Philip Bußmann und die Kostüme von Ilse Vandenbussche akzentuieren das Sujet des Theaters und stellen damit Höfgens selbstgewählte Heimat – die Bühne – in den Vordergrund.
Text: Hannah Stollmayer
Komponist Karol Nepelski im Gespräch mit Dramaturgin Hannah Stollmayer:
Komponist Karol Nepelski bei der Arbeit im Staatstheater Wiesbaden
Karol Nepelski ist ein polnischer Komponist von Bühnenmusik für Oper und Theater sowie Filmmusik, der bereits mehrfach mit Luk Perceval zusammengearbeitet hat. Dramaturgiehospitantin Anna Kudielka und Produktionsdramaturgin Hannah Stollmayer treffen ihn in einer Pause während der Endproben im Zuschauerraum des Großen Hauses.
Karol, du entwickelst die 3D-Bühnenmusik für Luk Percevals Inszenierung von „Mephisto“. Kannst du beschreiben, was das Besondere an deiner Arbeit ist?
Vielleicht fange ich damit an, wie Luk Perceval und ich uns vor einigen Jahren kennengelernt haben. Zum ersten Mal haben wir bei der Produktion „3STRS“ am Alten Nationaltheater in Krakau zusammengearbeitet. Luk hat auf den Proben viel mit den Schauspieler*innen improvisiert und das habe ich aufgenommen. Ich habe aufgenommen, wie die Spieler*innen ihren Text gesprochen, wie sie gesungen oder einfach Geräusche aus ihrem Hals, ihrer Kehle heraus oder mit dem Körper gemacht haben. So ähnlich habe ich es auch für „Mephisto“ gemacht. Mich interessiert vor allem, wie die Stimmen der Schauspieler*innen bearbeitet und von der Bühne zum Publikum transportiert werden können. Der nächste Schritt bei der Entwicklung der Bühnenmusik ist, dass ich alle Klänge schneide und in meinen Sampler integriere.
Und dieser Sampler sieht aus wie ein Keyboard?
Ja, genau. Das Besondere ist, dass jede Taste einen anderen Klang produziert. Auf einigen Tasten hört man zum Beispiel die Singstimmen der Schauspieler*innen, auf anderen hört man die perkussiven Klänge,die wir mit den Schauspieler*innen im Tonstudio aufgenommen haben. Wenn ich auf eine Taste drücke, ertönt ein dumpfer Schlag. Da hat sich ein Spieler selbst auf die Brust geschlagen. Oder, wenn ich eine andere Taste drücke, hört man das Pfeifen von Hannah Lindner. Mit diesen Sounds kann ich dann genauso wie das Ensemble während der Proben improvisieren. Das Prozesshafte macht meine Arbeit zu einem großen Teil aus: Ich bin immer auf den Proben und gebe live die Geräusche in die Szenen rein.
Und was genau ist 3D-Sound?
Das ist einfach: Der Ton kommt nicht nur aus zwei Kanälen von links und rechts, sondern auch von hinten oder von oben. Hier im Großen Haus haben wir zum Beispiel auch einen Lautsprecher in der Kuppel und hinter der Bühne. Insgesamt verfüge ich über acht Kanäle, über die der Ton abgespielt werden kann. So kann ich acht Lautsprecher einzeln im Raum anspielen und den Sound gewissermaßen wandern lassen. Dieser 3D-Sound erzeugt im besten Falle die Wirkung, als würde man im Kino sitzen. Er zieht das Publikum stark in das Geschehen auf der Bühne hinein und löst die die Grenze zwischen Bühne und Zuschauerraum akustisch auf.
Was für Töne hast du für „Mephisto“ benutzt, die mit dem Stoff zusammenhängen?
Unsere Aufführung ist ziemlich ungewöhnlich, weil wir kein klassisches Bühnenbild haben. Deshalb erschaffen wir das Bühnenbild aus Klängen, Stimmen, dem Licht und den Körpern der Schauspieler*innen. Die Klänge und Stimmen tragen die gesamte Dramaturgie dieser Aufführung mit und begleiten das Ensemble auch beim Tanzen. Außerdem verwenden wir Fragmente von Reden verschiedener Diktatoren. Ich nutze zum Beispiel eine in Finnland im Geheimen aufgenommene Rede von Hitler, in der man seine normale, sehr tiefe und ruhige Stimme hören kann, oder einen Ausschnitt einer Rede von Goebbels. Und dann collagiere ich die Ausschnitte mit anderen Sounds – Hitlers Stimme mische ich mit perkussiven Sounds und Stimm-Samples unserer Spieler*innen. Zu Beginn unserer Probenzeit bin ich mit den Schauspieler*innen ins Tonstudio gegangen und habe sie gefragt, was einer der wichtigsten Sätze ihrer Figuren ist. Ihre Stimmen habe ich dann in drei verschiedenen Tonstärken aufgenommen: flüsternd, ganz normal sprechend und laut sprechend. Jede*r konnte wirklich das sagen, was ihm oder ihr wichtig ist. Die Schauspieler*innen sind so auch ganz konkret in die Entstehung der Bühnenmusik eingebunden. Beim Sampling gibt es dann viele Möglichkeiten, wie man musikalisch mit dem Material umgehen kann. Jedes Sample ist ein neues Instrument, das man erlernen muss und so entsteht eine ganz eigene Musik.
Behind the scenes:
Content-Creatorin Mariia Shulga hat den Probenprozess fotografisch begleitet.
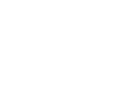
Das "Mephisto"-Ensemble mit Choreograf Ted Stoffer auf der Probebühne
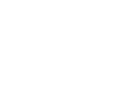
Laura Talenti, Christian Klischat

Luk Perceval, Lennart Preining und Christian Klischat im Gespräch

Felix Strüven, Hannah Lindner

Lennart Preining

Felix Strüven

Christian Klischat
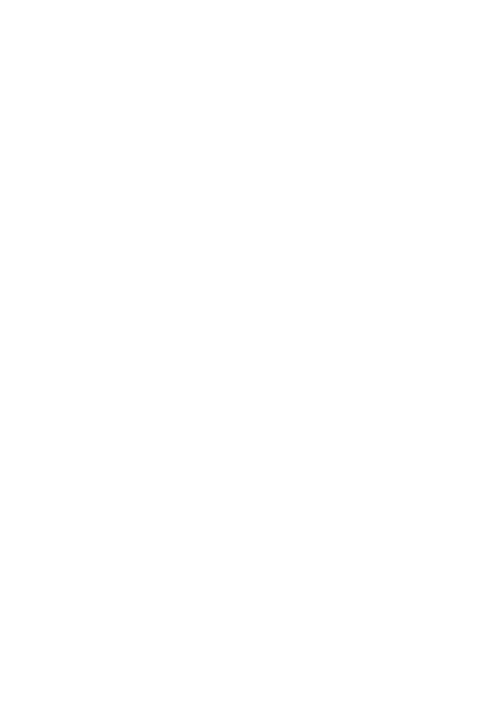
Süheyla Ünlü
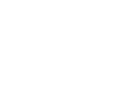
Ted Stoffer und Christian Klischat
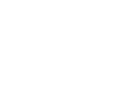
Ted Stoffer, Luk Perceval, Laura Talenti, Christian Klischat
Weiterführende Inhalte:
Gustaf Gründgens im Gespräch (1963):
In der Rolle des „Mephisto“ blieb Gründgens bis heute in Erinnerung. Im Interview mit Günther Gaus spricht er 1963 über seine zwiespältige Haltung gegenüber dem NS-Regime im Deutschland der 1930er Jahre. Im ZDF Archiv können Sie das Gespräch in der Reihe „Zur Person“ sehen.
„Kein Schlüsselroman. Eine notwendige Erklärung“ von Klaus Mann:
In einer schriftlichen Erklärung an die Redaktion der „Pariser Tageszeitung“ kritisiert Autor Klaus Mann die Bezeichnung von „Mephisto“ als Schlüsselroman.
„Mensch!“ von Michel Friedman:
Der Rechtsanwalt, Philosoph, Publizist und Moderator Michel Friedman über sein Sachbuch „Mensch! Liebeserklärung eines verzweifelten Demokraten“ und den Stand unserer Demokratie. Interview im SWR3-Podcast „Talk mit Thees”
Imiona nurtu. Die Namen der Strömung:
Das Hörspiel-Oratorium von Kai Grehn möchte unter Verwendung der Sterbebücher von Auschwitz den verzeichneten Menschen eine Stimme geben, jedem eine eigene. Auch Ensemblemitgliedern des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden haben diesem Projekt ihre Stimme geborgt.